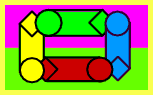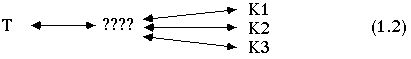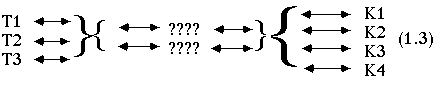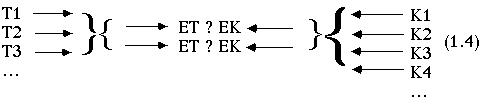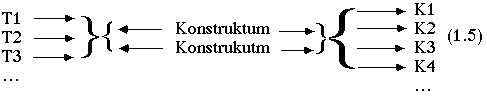|
Alfred Lang |
University of Bern Switzerland |
|
Book Section 1964 (Chapter 1, Einleitung) |
|
Über zwei Teilsysteme der Persönlichkeit
Beitrag zur psychologischen Theorie und Diagnostik |
1964-02 Zwei Teilsysteme 27KB
|
(Diss. phil., Universität Bern, 1964) Bern, Huber, 1964 (147 S.) |
- >>> Diss.Inhalt + Abstract
- >>> Diss.Lewin
- >>> Von Lewin gelernt
- >>> Lewin Genesereihen
- >>> Diagnostik & Ethik
|
First posted 1998.11.01
Calls since 2004
Last Revision:
2011-09-26 9:36
|
- This text is from LangPapers.org
- Called down <%response.write (FormatDateTime(Now(),1)&"")%>
- © 1960ff. by Alfred Lang
- Scientific and educational use permitted
|
|
1.Einleitung
PSYCHODIAGNOSTIK UND PERSÖNLICHKEITSTHEORIE
>«Wir sahen, daß es unmöglich ist, die spezifischen Eigenschaften von Individuen dadurch zu bestimmen, daß man sie nach ihrem sichtbaren Verhalten klassifiziert.» LEWIN, 1963/327
«Das Verfahren aber, dessen sich die Naturerkenntnis zur Ableitung des Zukünftigen aus dem Vergangenen bediene, bestehe darin, daß wir uns 'innere Scheinbilder oder Symbole' der äußeren Gegenstände machen, dievon solcher Art sind, daß die denknotwendigen Folgen der Bilder stets wieder die Bilder seien von den naturnotwendigen Folgen der abgebildeten Gegenstände.» GOLDSTEIN, I934/248 (nach HEINRICH HERZs Vorrede zu seinen Prinzipien der Mechanik, I 894)
Es ist eine der erstaunlichsten Tatsachen der angewandten Psychologie, daß sich die sogenannten projektiven Methoden oder Persönlichkeitstests wie Rorschach, TAT usf. in der praktischen Anwendung durchaus bewähren, während ihre wissenschaftliche Bewährungsprüfung trotz bald dreier Jahrzehnte intensivster Bemühungen immer noch aussteht. Diese diagnostischen Hilfsmittel sind aus der Beratungs- oder Personalauswahlpraxis unmöglich mehr wegzudenken; was in den USA «klinische Psychologie» heißt, ist weitgehend Testpsychologie. Dennoch haben die Tausende von Validierungsuntersuchungen, die auf methodologisch-wissenschaftlicher Grundlage bisher unternommen wurden, zwar dieses oder jenes Detail unter diesen oder jenen Vorbehalten bestätigen können; im ganzen sind sie jedoch ein gewaltiger Mißerfolg. Weder die Zuverlässigkeit (Reliabilität) noch die Gültigkeit (Validität) der Testdaten konnten in hinreichendem Ausmaß belegt werden, es sei denn, die Interpretationsbedingungen wurden in einer Art und Weise eingeschränkt, daß die Ergebnisse für die Praxis fast ohne Belang sind.
Ohne Zweifel geht vom genialen Entwurf dieser Methoden eine große Faszination aus, und ihre wissenschaftlich fundierte Begründung ist ein echtes Bedürfnis. Die eingangs erwähnte Diskrepanz zwischen praktischer und wissenschaftlicher Bewährung hat seltsamerweise zur Bildung zweier Parteien geführt; die Wissenschaftler - in extremer Weise etwa EYSENCK Ð verneinen ihre Bewährung und verwerfen die projektiven Methoden insgesamt als subjektiv, während die Praktiker Ð ZULLIGER, BOHM, BECK, KLOPFER, HERTZ und andere Ð auf ihre richtigen Diagnosen verweisen und je nach Temperament den wissenschaftlichen Bemühungen verständnislos oder skeptisch gegenüberstehen oder ihre Spekulationen wissenschaftlich verbrämen, so daß allzu oft Hypothesen unter Gutgläubigen als Fakten Verbreitung finden. Beide Reaktionen sind zwar verständlich, dienen aber wenig der Sache. Vermutlich gehört es allgemein zum Erscheinungsbild einer jungen Wissenschaft, daß die gesellschaftlichen Bedingungen der Zeit ihre Anwendung fordern, obgleich ihre Methoden dazu noch nicht reif sind; die Nur-Praktiker treten dann in die Lücke.
Das gegenseitige Unverständnis der beiden Parteien könnte aber auf einem Mißverständnis beruhen, das gerade, weil die Standpunkte vom einzelnen Psychologen gewöhnlich nicht so extrem eingenommen werden, wie wir sie eben geschildert haben, bisher nur selten aufgezeigt worden ist. Ein Anstoß zu unseren Uberlegungen lag in einem gelegentlichen Hinweis von TOMKINS (in einer Buchrezension im. J. proj.Techn.), die projektiven Verfahren seien eigentlich bloß «Einrichtungen zum Datensammeln »; dem widerspricht der weithin üblich gewordene Wortgebrauch des projektiven oder Persönlichkeitstests, da Test Prüfung in bezug auf einen Standard bedeutet.
In der Tat, es gibt zweierlei persönlichkeitsdiagnostische Verfahren, oder vielmehr: es gibt erst eins, während das andere noch weitgehend der Entwicklung bedarf. Wir suchten eine Erklärung für die Diskrepanz zwischen der praktischen Bewährung und dem Mißerfolg der wissenschaftlichen Validierung. Die Praktiker beziehen sich in ihrer Aussage auf die richtige Interpretation individueller Fälle mit Hilfe einer «diagnostischen Kunst» [l]. Die wissenschaftlich orientierten Psychologen haben jedoch bei ihren Validierungsbemühungen so etwas wie ein diagnostisches Instrument im Sinn. Statt nun solche diagnostischen Instrumente eigens zu konstruieren, wozu es glücklicherweise in der Psychometrie der Intelligenz schon bald nach dem zwiespältigen Erfolg der ad-hoc-Skalen kam, verwechseln sie die für die diagnostische Kunst gesammelten Daten mit psychometrischem Material: kein Wunder, wenn ihre Validierungsbemühungen scheitern! An dieser Verwechslung scheint RORSCHACH selbst nicht unbeteiligt, obgleich er sich über die Tatsache, daß er ein diagnostisches Kunstmittel propagierte, welches erst noch in ein Instrument umgearbeitet werden müßte, mehr Rechenschaft abgelegt hatte als mancher seiner Nachfolger. Es ist aber begreiflich, daß er den Unterschied unterschätzte, da er nicht wie wir heute über die Erfahrungen zweier Generationen in der Testkonstruktion verfügte. Wie wir zu zeigen versuchen werden, halten wir den Unterschied zwischen den beiden Verfahren für tiefgreifender, als daß man ihm durch Detailverbesserungen der klassischen Methode beikommen könnte, etwa nach den Vorschlägen von HERTZ (1959) durch bessere Lehrbücher und Normen und durch Vereinheitlichung der Testaufnahme, Befragung und Signierung.
Wir haben nun also eine Antwort auf die folgenden zwei Fragen zu finden:
1. Worauf beruht der praktische Erfolg der diagnostischen Kunst ?
2. Wie ist ein diagnostisches Instrument möglich ?
RORSCHACHS (1921) geniale Leistung war die Klassifizierung von irgendwie persönlichkeitsrelevanten Phänomenen. Man hat aber erst allmählich erkannt, daß die Phänomene nicht mit ihren Bedingungen gleichgesetzt werden dürfen, daß vielmehr jedes Phänomen mehrfach determiniert ist und jede Bedingung auf unterschiedliche Weise zu verschiedenen Phänomenen beitragen kann. Mit andern Worten: es ist ein Phänomeninsgesamt (das Testverhalten) von einem Bedingungsinsgesamt (den Persönlichkeitseigenschaften) wohl zu unterscheiden. Nur die diagnostische Zuordnung von Phänomenen und Bedingungen insgesamt ist sinnvoll und möglich, während die Rolle des einzelnen Phänomens im Phänomeninsgesamt sowie die Rolle der einzelnen Bedingung im Bedingungsinsgesamt frei bleiben. Aus dieser Erkenntnis heraus begannen sich die Rorschachforscher um die Gestaltpsychologie zu kümmern (BROSIN und FROMM, 1942; RICKERS-OVSIANKINA, 1943; BOHM, 1957 u. a. m.); diese Bemühung mußte aber schon infolge der Spezifität der klassischen Gestaltpsychologie im wahrnehmungspsychologischen Detail und ihrer ungeheuren Allgemeinheit im theoretischen Grundsatz Programm bleiben.
Die Frage nach dem praktischen Erfolg der diagnostischen Kunst ist nun wie folgt zu beantworten. Der Diagnostiker hat mit Hilfe psychologischer Spekulation und auf Grund gehäufter Erfahrung über eine Reihe von Phänomenen Hypothesen erarbeitet. Die Bedeutung dieser Testmerkmale ist dadurch zwar ein Stück weit eingeschränkt, die Fülle aller möglichen spezifischen Interpretationen, d.h. die Vieldeutigkeit der gesammelten Daten, aber immer noch zu groß. Nun nimmt der Diagnostiker Zuflucht zu einer plausiblen theoretischen Voraussetzung. Er sagt sich, daß die individuelle Persönlichkeit - also das Bedingungsinsgesamt der in einem bestimmten Fall zu interpretierenden Daten - ein irgendwie einheitliches, relativ geschlossenes und relativ einfaches Ganzes sein muß. Unter dieser Voraussetzung lassen sich im Phänomeninsgesamt die Widersprüche der möglichen Interpretationen aufheben und Lücken systemimmanent interpolieren. Mit Vorteil werden gemäß der bekannten Regel Daten mehrerer verschiedener Verfahren auf diese Weise verarbeitet. Die Polyvalenz der Einzelmerkmale wird also durch ihre Einbindung in ein ganzheitliches System und durch vielerlei Querverbindungen untereinander eingeschränkt; die «Gestalt» der individuellen Persönlichkeit hebt sich gesichert heraus. Wir sprechen ausdrücklich von einer theoretischen Voraussetzung, die keinesfalls als eine Tatsache genommen werden darf. In der Tat mutet die Persönlichkeitsbeschreibung häufig fragmentarisch an und bleibt unsicher, wenn die Voraussetzung - wie etwa bei gewissen Schizophrenen - nicht erfüllt ist. Es scheint, daß der Rorschach seine ausgezeichnete Stellung unter den persönlichkeitsdiagnostischen Verfahren dem Umstand verdankt, daß seine Merkmale umfassend genug sind, um fast in jedem individuellen Fall diese ganzheitliche Interpretation zu erlauben. Eh und je wird sich eine diagnostische Kunst eines solchen individualisierenden Verfahrens bedienen wollen und in der persönlichen Begegnung von Ratsuchendem und Diagnostiker bedienen müssen, wenngleich es sich in mancher Hinsicht lohnen dürfte, das im Individualsystem zu interpretierende Material weitergehend mit wissenschaftlichen Methoden aufzuarbeiten, als es bis heute geschieht. Die Arbeit des Diagnostikers wird dadurch nicht unbedingt vereinfacht, wohl aber das Eingehen auf die Feinheiten des jeweiligen besonderen Falles erleichtert.
Der diagnostischen Disziplin im gesamten stellen sich aber noch andere Aufgaben, die, wie schon angedeutet, im Wort «Test» angezielt sind: nämlich ein Individuum unter bestimmten Gesichtspunkten an einem Standard zu prüfen, d.h. in einer konkreten und begrenzten Fragestellung eine Entscheidung zu treffen (DAVID und RABINOWITZ, 1960). Hier kann sich die Diagnostik nicht mehr im Individualsystem einer Persönlichkeit abspielen, vielmehr gehen bestimmte Momente des Individuums mit den entsprechenden Momenten anderer Individuen in ein übergreifendes System ein, beispielsweise ihre Intelligenzgrade in das Bezugssystem der Intelligenz. Eine Entscheidung darüber, ob ein Individuum N zur Lösung einer gegebenen Aufgabe befähigt ist, kann nur in einem überindividuellen Begriffssystem getroffen werden, in welchem einerseits die «Intelligenzen» aller Individuen - und darin der Ort von N -, und anderseits der «Intelligenzbedarf» aller Probleme - mit dem fraglichen Problem an seinem bestimmten Ort - einander zugeordnet werden. Mit andern Worten, es interessiert eine allgemeine und differentielle Theorie der Intelligenz, welche auf N angewendet werden kann. In diesem Sinn war ein eindimensionales Bezugssystem (symmetrische Verteilung um den Durchschnitt) der globalen Intelligenzgrade die große Errungenschaft der Anfänge der Psychodiagnostik; in faktoriellen Ansätzen ist man daran, komplexere und offenbar adäquatere Theorien der Intelligenzstruktur zu entwickeln.
Wir sind somit bei unserer zweiten Frage angelangt: wie ist ein persönlichkeitsdiagnostisches Instrument möglich? Offenbar muß sich auch das diagnostische Instrument auf einen Systemzusammenhang stützen, aus dem heraus jeweils die Rolle der einzelnen Phänomene sowie der Bedingungen bestimmt wird; es muß sich aber dabei um ein überindividuelles Bezugssystem, um eine allgemeinpsychologische Theorie mit einem differentialpsychologischen Aspekt handeln. Unsere zweite Frage läßt sich nun dahin präzisieren, wie ein solches übergeordnetes Bezugssystem beschaffen sein müsse. Zu ihrer Beantwortung müssen wir etwas weiter ausholen.
Diagnostik hat zum Ziel, ein Individuum auf irgendeine Weise derart zu «erfassen», daß Aussagen über sein Leben zu einem andern Zeitpunkt, vorher oder nachher, möglich sind. Die Individualität, die in der psychologischen Diagnostik in Frage steht, manifestiert sich im Erleben und Verhalten. Anderes als das eigene Erleben ist uns freilich nie direkt, sondern immer nur durch einen Erlebnisbericht, durch Ausdruck usf., allgemein also durch Verhalten zugänglich. Was wir bisher als «Phänomene» bezeichnet haben, ist mithin für das diagnostische Instrument in jedem Fall ein Verhalten irgendwelcher Art. Je einfacher und elementarer die Verhaltensphänomene sind, desto zuverlässiger können sie festgestellt werden. Wir unterscheiden nun Testverhalten und Kriteriumsverhalten. Testverhalten ist das durch systematische Beobachtung oder in einem Versuch gesammelte Phänomenmaterial. Als «Kriterium» bezeichnet man im allgemeinen das in Validationsstudien mit dem diagnostischen Testverhalten verglichene Alltagsverhalten; der Einfachheit halber diene der Begriff im folgenden etwas erweitert auch zur Bezeichnung des diagnostisch vorauszusagenden Verhaltens im Leben überhaupt.
Damit ergibt sich als die Aufgabe der psychologischen Diagnostik die gegenseitige Zuordnung von Test- (T) und Kriteriumsverhalten (K):

Bei einem vollständig «erfaßten» Individuum sollte sowohl aus dem Testverhalten das Kriteriumsverhalten wie auch aus dem Kriteriumsverhalten das Testverhalten vorausgesagt werden können. Praktisch muß die Diagnostik natürlich ganz bestimmte, möglichst umfassende Verhaltensweisen herausgreifen und sich auf ihre Voraussage beschränken. Jede Zuordnung muß nach wissenschaftlichen Grundsätzen empirisch gesichert werden.
Infolge der unvergleichlich größeren Vielfalt des Kriteriumsverhaltens - Diagnostik möchte rationell aus möglichst wenig Daten möglichst viel Verhalten voraussagen - kann dieses nicht direkt dem Testverhalten zugeordnet werden; irgendwelche Hilfsbegriffe müssen dazwischentreten, welche die Zurückführung mehrerer Kriteriumsverhaltensweisen auf ein und dasselbe Testverhalten erlauben:
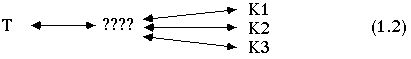
Die in der Darstellung (I.2) durch ???? gekennzeichneten Hilfsbegriffe entsprechen dem, was wir «Bedingungen» genannt haben. Die Verhältnisse komplizieren sich nun dadurch, daß, wie wir oben ausgeführt haben, Phänomen und Bedingung nicht eindeutig, sondern nur als Systeminsgesamt einander zugeordnet werden können. Einheiten auf der phänomenalen Ebene brauchen nicht notwendig mit Einheiten auf der Bedingungs- oder konditional-genetischen Ebene zusammenzufallen, und die Beziehungen zwischen den beiden Ebenen können beliebig und je nach den jeweiligen aktuellen Umständen auch unterschiedlich sein. Diese Ganzbestimmtheit der Einzelphänomene und -bedingungen sei durch die zwischengefügten Klammern angedeutet:
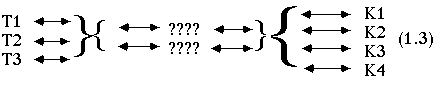
Damit läßt sich unsere Frage nach der Möglichkeit des diagnostischen Instruments zum zweitenmal präzisieren: wie sollen diese vermittelnden Hilfsbegriffe beschaffen sein, und wie werden sie am besten gewonnen ? Zwei Wege bieten sich an. Der erste erschließt sie induktiv mit Hilfe von klassifizierenden und abstrahierenden Operationen sowohl aus dem Testverhalten wie aus dem Kriteriumsverhalten. In diesem Fall bezeichnen wir die Hilfsbegriffe oder Bedingungen des Verhaltens als Eigenschaften (E). Die Verhältnisse stellen sich nun wie folgt dar:
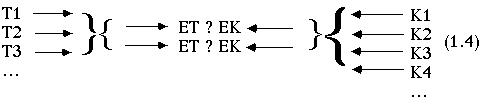
Wie aus der Darstellung (1.4) ersichtlich ist, liegt die Schwierigkeit dieses induktiven Vorgehens bei der Beziehung zwischen den von der einen wie von der andern Seite her je für sich gewonnenen Eigenschaftsbegriffen. Der vorwissenschaftlichen Menschenkenntnis ist die Gleichsetzung ET = EK dann selbstverständlich, wenn Testverhalten und Kriterium einander phänomenal ähnlich sind: wer beispielsweise jetzt und hier lügt, ist ein Lügner, und ein Lügner wird abermals lügen. Oft werden dann Eigenschaften und Phänomene - die Sprache verleitet dazu - gar nicht eigens unterschieden. Leider hat die wissenschaftliche Diagnostik diesem Kurzschluß-Denken oft zu wenig Mißtrauen entgegengebracht. Selbst wenn die Zuordnung von Testverhalten und Eigenschaft ET sowie die Zuordnung von Kriteriumsverhalten und Eigenschaft EK je für sich ein-eindeutig möglich wäre, kann im induktiven Vorgehen doch niemals für eine richtige Gleichsetzung ET = EK garantiert werden. Die beiden Klassifikations- und Abstraktionsbereiche bleiben begrifflich getrennt; es sei denn, das Testverhalten wäre mit dem Kriteriumsverhalten identisch; dann hat aber Diagnostik keinen Sinn.
Die Unsicherheit der Gleichsetzung ET = EK ist dadurch noch erhöht, daß die Merkmalsklassifizierung und die Abstraktion der psychologischen Bedeutung stets nur in Individualsystemen sauber vollzogen werden können. Sobald verschiedene Individualsysteme zu einheitlicher Klassifizierung miteinander verglichen werden sollen, stellt sich das Problem der bedingungsmäßigen Gleichsetzung von phänomenal Gleichem schon auf der Ebene der Phänomene erneut. Es ist aber nicht immer dasselbe, wenn zwei dasselbe tun. Wiederum kann nur auf induktivem Weg entschieden werden.
Mit dieser Argumentation sollen nun keineswegs die Induktion und der Eigenschaftsbegriff in Bausch und Bogen verworfen werden. Man muß sich aber über die Grenzen beider im klaren sein. Beide sind vorwissenschaftlich höchst nützlich und überdies unentbehrlich als Ausgangsbasis für das nun zu beschreibende deduktive Vorgehen. Wir bezeichnen die vermittelnden Hilfsbegriffe dann als Konstrukta, wenn sie als die Bedingungen des Verhaltens primär als Begriffe, d.h. als Bestandteile des theoretischen Systems, definiert sind, so daß sowohl Test- wie Kriteriumsverhalten aus ihnen deduziert werden können:
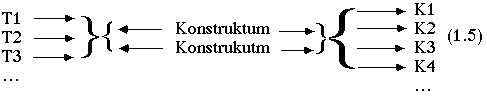
Aus der Darstellung (1.5) geht hervor, daß jetzt nur noch die Schwierigkeit zu schaffen macht, das Verhältnis zwischen den Phänomenen und ihren Bedingungen als Systemzusammenhänge zu begreifen. Es ist für Testverhalten und Kriterium dasselbe Problem. Hingegen entfällt die Gleichsetzungsunsicherheit ET ? EK, da sowohl das Testverhaltensinsgesamt wie das Kriteriumsverhaltensinsgesamt aus der gleichen theoretischen Konstruktion abgeleitet werden können. Auch wird die Identifizierung der Phänomene des Testverhaltens wesentlich erleichtert, da nicht mehr die Verhaltensweisen verschiedener Personen miteinander verglichen werden müssen, um zu einer allen gemeinsamen Klassifizierung und Abstraktion zu gelangen; vielmehr können die Verhaltensphänomene jedes Individuums für sich bloß daraufhin geprüft werden, ob sie eine bestimmte, aus dem theoretischen Konstruktum abgeleitete operationale Definition erfüllen oder nicht. Selbstverständlich ist die inhaltliche Bestimmtheit von solchen Konstruktionen nicht denkbar ohne vorausgehende vorwissenschaftliche und wissenschaftliche Induktionen. Im Prinzip sind aber die Konstrukta, wie EINSTEIN (1933) betont, «frei erfunden», wenngleich natürlich im Hinblick auf Tatsachen der Erfahrungswelt. In der entscheidenden verifizierenden Phase der Testkonstruktion muß dann aber das deduktive Vorgehen unter dem methodischen Primat der Theorie gefordert werden, soll die Zuordnung von Test- und Kriteriumsverhalten nicht unüberprüfbare Sprünge aufweisen.
Ein persönlichkeitsdiagnostisches Instrument ist also möglich, wenn auf theoretischer Grundlage einschlägige Persönlichkeitskonstrukta begrifflich definiert werden können und wenn es gelingt, sie einerseits in zuverlässiger Weise empirisch darzustellen, d. h. in Form von Testverhalten zu erfassen, und sie anderseits in diagnostisch relevanter Weise in Kriteriumsverhalten zu übersetzen. Die vorliegende Arbeit versucht im ersten Teil die begriffliche Definition und im zweiten Teil die empirische Darstellung eines solchen Persönlichkeitskonstruktums.
Fussnote:
#[l] Man vergleiche den Ausdruck «ärztliche Kunst».
Top of Page